|
<-
Stilkunde - Jugendstil ->
<- Archiv -
Jugendstil ->
|
Produktiv Genossenschaft von
Kunsthandwerken
Wien VII, Neustifftgasse 32
Anfang des Jahres 1900 beginnt sich ein
grundsätzlicher Stilwandel bemerkbar zu machen. Mit einer
Abkehr von den Kurvenschwüngen der Secession und des Art
Nouveau, mit einer Wiederbelebung klassizistischer Ideale fand eine
Hinwendung zu einfacheren Formen statt. Bedeutend waren in dieser
Periode zweifellos die Kontakte zu englischen bzw. schottischen
Zeitgenossen wie Charles Rennie Mackintosh.
Der junge Industrielle und Kunstfreund Fritz
Wärndorfer besuchte mit Josef Hoffmann Charles Rennie Mackintosh in Schottland. Die
Idee der Wiener Werkstätte reifte.
Mit dem Vermögen von Fritz Wärndorfer und dem
Enthusiasmus von Josef
Hoffmann wie Koloman Moser wurde im Mai 1903 die Wiener
Werkstätte danach gegründet (1903-1932). Josef Hoffmann und Kolo Moser übernahmen
die künstlerische Leitung.
Zielsetzungen der Wiener Werkstätte waren: Eine Fülle von
Gegenständen neu zu entwerfen, die für den täglichen
Gebrauch oder auch nur zur Schmückung bestimmt waren. Nur
Gegenstände aus der Hand zu geben, die eine ausgesprochene
Marke von Individualität, Schönheit und exaktester
Ausführung tragen.
Die Genossenschaft verfügte über
Werkstätten für Gold-, Silber- und Metallarbeit, für
Buchbinderei, Leder, Tischlerei und Lackiererei. Sie erzeugten alle
Arten kunstgewerblicher Gegenständen und übernahmen die
Einrichtung und Bau ganzer Häuser. Die Möbel waren
anfangs nur mit einem von Mackintosh entworfenen Schlüssel
gekennzeichet. Nach 1904 wurde die Schutzmarke "sogenante
Rosenmarke" das Markenzeichen am Schloß und Schlüssel.
Kleine Objekte (wie Holzkassetten und ähnliches) waren am
Boden mit der Schutzmarke, das Monogrammm des Entwerfers und des
ausführenden Meisters gekennzeichnet.
Josef Hoffmann wie auch Koloman Moser nahmen am Anfang die Einfachheit
und Einheit der quadratischen Elemente "Schwarz und Weiß"
deswegen sehr intensiv auf, weil diese "klaren Elemente" niemals in
früheren Stilen erschienen waren (Foto 1, 2, 3, 5). Selbst die
Ausstattung wie Objekte demonstrieten die Vorstellung der beiden
Künstler über eine zeitgemäße Inneneinrichtung,
"Hygiene ist die Grundlage der augenfälligen Schönheit;
mit Licht, Reinheit und guter Luft ist die Hauptsache bestritten",
hieß es.
Die Entwürfe waren so eng gebunden,
daß man auch nachträglich, es sehr schwer hat (wo es kein
Bildnachweis gibt) eine genaue Zuschreibung abzugeben (Foto 2,
3).
Schon beim Sanatorium Purkersdorf (1903-1906) bediente sich
Josef Hoffmann des
modernsten bautechnologischen Hilfsmittels, das zur Verfügung
stand. Durch die Zusammenarbeit mit Jacob & Josef Kohn entstanden die
Sitzmöbel im Speiseraum (Foto 4). Bei Koloman Moser waren es die
Sitzmöbel im Empfangsraum (Foto 5) die von der Firma Prag Rudniker Korbwaren
Fabrikation ausgeführt wurden. Das restliche
Einrichtungsinventar stammte von der Wiener Werkstätte (Foto
6).
Das Palais Stoclet (1905-1911) in Brüssel kann als
der Höhepunkt des Schaffens der Wiener Werkstätte gesehen
werden. Nicht nur Materialien und Verarbeitungstechnik waren
aufwendiger geworden, es ist ab 1905 ein neuerlicher
Richtungswechsel in der gestalterischen Tätigkeit zu erkennen.
Wobei man erwähnen muss: Beim Palais Stoclet war das
Verhältnis zwischen Auftraggeber und Architekt das denkbar
glücklichste. Dies ist in der Qualität erkennbar, wobei
in der Gestaltung offenbar keinerlei Kompromisse eingegangen wurden
sowohl bei Außengestaltung als auch bei der
Inneneinrichtung.
1906 schied Koloman (Kolo) Moser aus der Genossenschaft aus.
"Neben und mit seinem Freund Josef Hoffmann hat Kolo Moser als Reorganisator des Wiener Kunstgewerbes
in jahrelanger Tätigkeit gewirkt und einen künstlerische
hochwertigen Nachwuchs erzogen. Nach dieser kunstpolitisch und
pädagogisch ungemein wichtigen Leistung widmete er sich wider
seiner unterdrücken Neigung - die Malerei".
Der Künstlerische Direktor blieb Josef Hoffmann, der dann als Mitarbeiter nach
und nach junge Künstler - Kunstgewerbeschule - heranzog. Wie
1906 Carl Otto Czeschka `s Einstandsarbeit für die Wiener
Werkstätte, die sogenannte "Kaiserkassette" vielbestaunter Mittelpunkt des
WW-Raumes bei der "Imperial Royal Austria Exhibition" in London
sich zeigte.
Zu dieser Zeit
revoltierte Adolf Loos gegen die
Revoltierenden. Der Höhepunkt von Adolf Loos war seine Schrift von 1908 „ Ornament und Verbrechen
„ wo Koloman Moser, Josef Hoffmann
und die Wiener Werkstätte
direkt angegriffen (Quadratseuche)
wurden.
Nach 1908 entwarf Karl Bräuer
Innenräume, etwa seit 1910 Eduard Wimmer, der auch Leiter der
Modeabteilung war. Nach 1912 hat vor allem Dagobert Peche (Foto 9)
den Stil der Wiener Werkstätte stark beeinflußt. Die
Tischler, Zimmer und Bautischler waren nach 1908 nicht in der
Neustifftgasse, sondern in anderen Räumen untergebracht. Die
Ausführung an großer Möbelstücke wurde an
selbständige Tischler vergeben, die für die Wiener
Werkstätte arbeiteten. Zu diese gehörten nach 1914 in
erster Linie Wenzel Hollmann, Jacob Soulek, J.W. Müller und
Anton Postpischil, die seit vielen Jahren mit Josef Hoffmann in
Verbindung standen. Anspruchvolle dekorative Arbeiten führte
der Holzbildhauer Josef Albrecht aus.
Die Wiener Werkstätte wurde mehrfach
reorganisiert, was mit der finanziellen Lage zusammenhing. 1914
wurde sie (nach einem Ausgleich) in eine Betriebsgesellschaft
m.b.H. der Wiener Werkstätte und 1921 in " Wiener
Werkstätte Gesellschaft m.b.H. umgewandelt.
Am 14. Oktober 1932 wurde die Wiener Werkstatt
liquidiert und am 3. Februar 1939 endgültig gelöscht.
Wichtige Bauten wie Einrichtungen neben dem
Palais Stoclet und Sanatorium Purkersdorf waren daß Kabarett
Fledermaus, Wohnung Ast, Brauner, Flögl, Hochreith, Mautner
Markof, Moll, Knips Seewald und Wittgenstein. Die wichtigsten
Ausstellungen waren 1904 in Berlin, 1905, 1908 in Wien und 1906 in
London. Ihre Bauten, Wohnungseinrichtungen und Teilnahme an vielen
anderen Ausstellungen im In- und Ausland könne kaum
aufgezählt werden.
Lit.: Wiener Werkstätte - Kunst und
Handwerk 1903-1932 - Werner J. Schweiger
Lit.: Wiener Werkstätte - 100 Jahre Wiener Werkstätte -
Mak Museum Wien
Lit.: Josef Hoffmann - Das architektonische Werk - Eduard F.
Sekler
Lit.: Koloman Moser - Leben und Werk 1868-1918 - Maria
Rennhofer
|
|
|
|

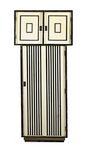


.





|
|
|
|
|
|
|
<-
Stilkunde - Jugendstil ->
<- Archiv -
Jugendstil ->
Voglhofer Stefan
Meierhof Schloß Schwertberg w.z.B.: Josef
Hoffmann, Adolf Loos, Adolf Loos Bauschule,
Kolo Koloman Moser, Otto
Wagner, Gustav Siegel Siegl, Otto
Prutscher,
Dagobert
Peche,
F.O. Friedrich Otto Schmidt, Portois Fix,
Thonet, Jacob Josef Kohn J
J, Wilhelm
Schmidt, Prag Rudniker
Korbwarenfabrik,
Ferdinand
Kramer, Marcel Kammerer, Erich
Dieckmann,
Mercel
Breuer, Ludwig Mies van der
Rohe, Deutscher
Werkbund, Österreichischer
Oesterreichischer Werkbund, Wiener Werkstatt
Werkstätte, Otto
Wytrlik, Wittgenstein, Eduart Wimmer, Hans Vollmer, Josef
Urban, August
Ungethüm, Wiener
Secession,Ludwig
Schmitt, Sanatorium
Purkersdorf,
Josef Maria
Olbrich, Hans
Ofner, Mundus, Bernhold
Löffler, Le
Corbusier, W. Hollmann,
Haagenbund, Bauhaus, Leopold
Bauer, Josef
Frank, Mautner Markhof,
Franz von Zülow, Gustav Klimt, Egon Schiele, Bruno Paul, Karel
Ort, Walter Knoll, Josef Albers, Jindrich
Halabala, Up, Anton
Lorenz, Hans Luckhardt, Franz Singer, Jacob Julius Josef herrmann,
Michael Richard Niedermoser, Bernhard Ludwig, Sigmund Jaray,
Liberty Co, Postsparkasse Wien PSK
|
